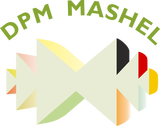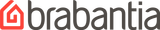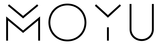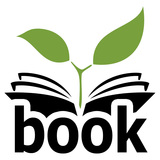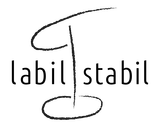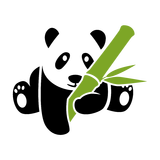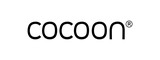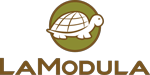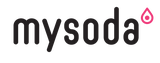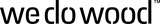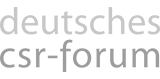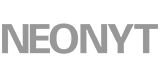Im Hinblick auf die Endlichkeit natürlicher Ressourcen und exorbitanten Abfallmengen von deutschlandweit zuletzt knapp 417 Millionen Tonnen ist Upcycling ein Hoffnungsschimmer: Es ist Recycling plus Wertschöpfung. Dabei werden die im Abfall gespeicherten Energien und Rohstoffe bewahrt und zu neuwertigen Produkten umgewandelt. Das Gute daran: Werden Rohstoffe wiederverwendet, müssen sie nicht durch Bergbau, Land- oder Forstwirtschaft neu beschafft werden und das wirkt sich wiederum hemmend auf den Energieverbrauch und die Luftverschmutzung aus. Inzwischen gibt es zahlreiche Unternehmen, die sich dem Thema angenommen haben und tolle Produkte vertreiben, die aus Upcycling entstanden sind: Von Upcycling Taschen über Kaffeetassen aus Kaffeesatz bis hin zu Upcycling auf Bestellung – Es gibt nichts, was es nicht gibt. In diesem Artikel stellen wir dir einige dieser Label, ihre Produkte und Upcycling-DIY Projekte, die du Zuhause nachmachen kannst, vor.
Was genau ist Upcycling?
Beim Upcycling geht es darum, Abfall, leere Verpackungen, alte Stoffe, usw. in neue und ganz andere Produkte zu verwandeln. Es geht nicht nur darum wiederzuverwerten, sondern vielmehr darum aufzuwerten und ein Unikat zu schaffen: aus verwaschenen Stoffen entsteht so z.B. ein schickes Kleid und aus alten Obstkisten kleine Regale oder Beistelltische.
1994 tauchte der Begriff Upcycling erstmals öffentlich auf, als der Ingenieur Reiner Pilz in der britischen Zeitschrift Salvo eine Wiederverwendung von Müll forderte. Sein Ruf wider der Verschwendung verhallte nicht ungehört und in der Folge entwickelte sich der Upcycling Trend.
In ärmeren Gesellschaften ist das alles nichts Neues, allein schon aus Materialarmut werden alte Stoffe traditionell wiederverwendet. Obwohl Industriegesellschaften eher im Wegwerfmodus verhaftet sind, schwappte das „aus alt mach neu“-Motto schließlich auch zu uns über und wurde als Ausdruck von Individualität zum Megatrend: Denn Upcycling ist kreativ und einzigartig.
Doch auch aus einem ökologischen Aspekt ist Upcycling eine super Idee, da "das Volumen an Müll steigt und steigt und steigt", wie eine Sprecherin der Umweltschutzorganisation Greenpeace, Kirsten Brodde, feststellte. Vor allem die riesigen Plastikmüllberge, die tagtäglich produziert werden, sind problematisch, da Plastik sehr lange benötigt, um von der Natur abgebaut zu werden: Es zerfällt erst nach rund 450 Jahren – und selbst dann bleiben für die Tierwelt schädliche Mikroplastikpartikel zurück.

Genug Gründe also, um sich ein paar Upcycling-Unternehmen und deren Produkte einmal genauer anzuschauen.
Bei diesen Unternehmen kannst du Upcycling-Produkte kaufen
Aluc
Das Berliner Startup Aluc produziert Hemden, Blusen und Kleider aus „Preconsumer Waste“, d.h. Fehlerware und Musterstoffe.
Carla Cixi Crocheting
Die Designerin Carla Cixi näht Kleidung für ihre Kundinnen und Kunden individuell und auf Bestellung. Oft bringen die Kundinnen und Kunden die Stoffe für das neue Outfit sogar selbst mit.
---Anzeige---
colorswell: Upcycling für Meer Style! Schützt die Meere – Seil für Seil
Begonnen hat alles 2015 mit einem Armband als Urlaubserinnerung. Wir waren in Portugal im Surfurlaub und sammelten den angespülten Müll am Strand. Was uns dazwischen immer wieder auffiel, waren die bunten Seile und Netze. Aus einem wurde dann ganz spontan das erste Armband. Heute sind wir „colorswell handmade design“ und sammeln seither angespülte Seile und Fischernetze am Strand, reinigen diese und designen daraus liebevoll handgemachte und einzigartige Upcycling Accessoires. Neben verschieden Armbändern designen wir auch Schlüsselanhänger, Ketten, Hundeleinen, Taschen und Blumenampeln.

Mit unserem StartUp wollen wir auf die Plastikverschmutzung aufmerksam machen. Daher geben wir Tipps, um Plastik und Müll zu vermeiden, einen zukunftsweisenden Lebensstil umzusetzen und setzen uns aktiv für den Erhalt unseres Lebensraumes ein. Mit jedem Kauf spenden wir 5% an unseren Partner die Meeresschutzorganisation „Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V.“
---Anzeige Ende---
manomama
Das Augsburger Unternehmen manomama zerlegt Textilreste und Schnittabfälle aus Nähereien in Fasern und verarbeitet sie zu neuem Garn für ganze Kollektionen.
Water to Wine
Abgenutzte Textilreste nutzt die Berliner Stadtmission seit 2013 noch ergiebiger: 200 Tonnen alter Kleidung spenden die Berliner*innen jedes Jahr dem kirchlichen Dienstleister. Was nicht für die sozialen Projekte oder die Second-Hand-Läden der stadtmissionseigenen "Komm-Und-Sieh"-Läden geeignet ist, geht an das Label Water to Wine. Dort verwandeln lokale Designer*innen die abgetragenen Materialien zu nachhaltiger Designermode.
Qmilch
Äußerst hautfreundlich sind die Kuhmilch-Kleider des Startups Qmilch. Die Mikrobiologin und Designerin Anke Domaske produziert aus nicht mehr verwertbaren Milchresten Fasern für die Bekleidungsindustrie. Allein in Deutschland werden pro Jahr rund zwei Millionen Liter Milch entsorgt, die Domaske nutzbar macht. 2010 erhielt sie dafür den Deutschen Gründerpreis.
Zierkeltraining
Die deutsche Firma Zirkeltraining fertigt Taschen aus dem Leder von Sportgeräten und Turnmatten, auf denen Schüler*innen ganzer Klassen jahrzehntelang ihre Turnübungen absolviert haben.
110 2.0 Shop – Upcycling uniform
Die Barmherzigen Brüder der gemeinnützigen Behindertenhilfe (BBBH) fertigen aus abgetragenen Polizeiuniformen Taschen und Rucksäcke
So einfach kannst auch du upcyclen

Jeder der upcycled, leistet mit dieser Form der "Zweckentfremdung" verschiedener Materialien, Behälter oder Verpackungen ein Stück Umweltschutz. Er trägt dazu bei, dass natürliche Ressourcen nicht immer weiter schwinden. Denn so viele Materialien und Stoffe werden ungeachtet in der Mülltonne entsorgt und in einen Kreislauf mit hohem CO₂ Ausstoß geführt.
Dabei können aus diesen Dingen mit etwas Kreativität nützliche und in ihrem Aussehen einzigartige Produkte entstehen. Es gibt praktisch kein nicht-verderbliches Material, das sich nicht zum Upcycling eignet: Einwegflaschen, Kunststoffverpackungen, Auto- und Fahrradreifen, alte Decken, verschlissene Gürtel, sowie nicht mehr getragene Kleidung. Außerdem jedes Glas, jeder nicht mehr benutzte Teller und jede Decke. Der Kreativität sind beim Upcycling keine Grenzen gesetzt und jede und jeder kann individuell und ganz nach eigenem Geschmack neue Dinge kreieren.
Abgetragene Kleidung kann günstig und ganz einfach selbst upgecycelt und ummodeliert werden. Die Arbeitsutensilien dafür sind meist in jedem Haushalt zu finden: Nadel, Schere, Stoffreste, ggf. Garn sowie Zierknöpfe. Schon durch einfache Ziernähte oder Stickereien können große Veränderungen erreicht werden. Auch das Annähen von Knöpfen, Perlen und Bommeln wertet ein Kleidungsstück individuell auf und versteckt eventuell verwaschene oder kaputte Stoffabschnitte.
In diesem Video werden dir 5 weitere Upcycling-Ideen vorgestellt. Viel Spaß beim Nachmachen.
Ein zweites Leben für Müll: Upcycling-Fazit
Upcycling gilt als die nächste Trendwelle. Nicht ohne Grund: Die Neuproduktionen von Rohmaterialien werden durch das Upcycling reduziert, was den Energieverbrauch, sowie die Luft- und Wasserverschmutzung verringert. Immer mehr Menschen wollen gegen den Schwund der natürlichen Ressourcen ankämpfen. Unternehmen, die Upcycling-Produkte verkaufen, helfen dabei, Ressourcen zu schonen und nicht noch mehr Abfall zu produzieren, sondern sogar dafür, dass der bestehende Abfall sogar reduziert wird. Genau das kannst auch du in deinen 4 Wänden mit einfachen DIY Projekten machen. Egal auf welchem Wege du den Wiederverwertungs-Trend unterstützt: Wilkommen in der Upcycling-Bewegung.
_________________________________
Lies auch:
Old but Gold - Elektroschrott? Nein, danke!
Folge uns auch gerne auf Instagram: LifeVERDE
03.07.2016
LG Sabine
24.05.2016
Ich find das richtig toll und es gibt einen ein bisschen Hoffnung.
Liebe Grüße Claudia
03.05.2016


 Kommentar erstellen
Kommentar erstellen












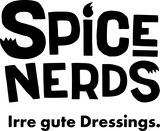








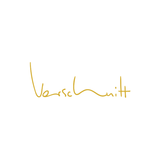










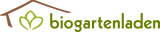


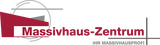













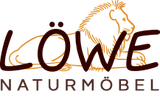








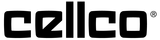









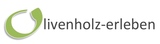








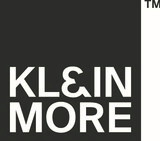


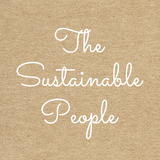







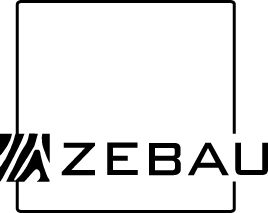












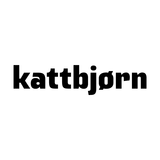






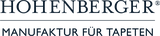






















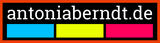




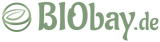

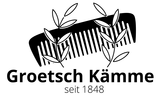













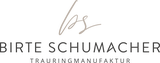








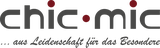




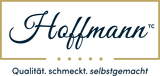


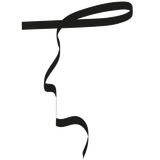




















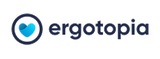

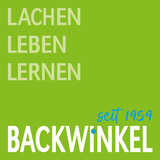






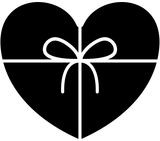





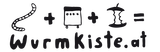













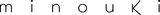

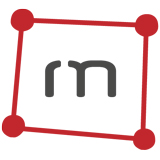




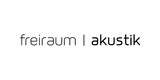






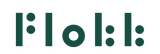






















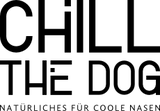


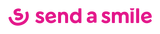


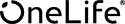



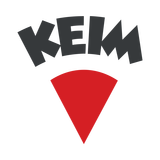




















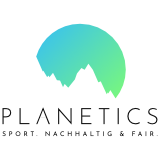


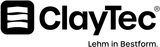












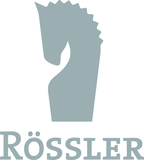
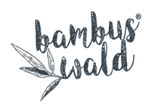





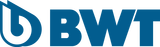


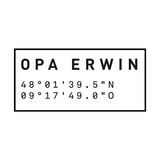


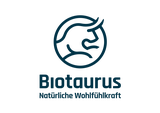











.png)